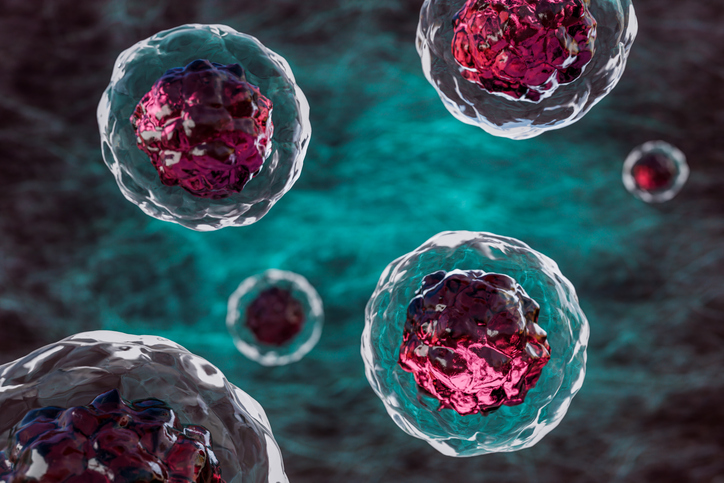Alle 11 Minuten stirbt in den USA jemand durch Selbstmord. Der Kummer, jemanden auf diese Weise zu verlieren, ist tief und oft fragen sich die Hinterbliebenen: Wie konnte das ohne Vorwarnung passieren?
In der Vergangenheit wurde Suizidalität als Symptom anderer psychischer Probleme, insbesondere Depressionen, gebrandmarkt. Während meiner medizinischen Ausbildung wurde uns beigebracht, dass wir seine Depression behandeln sollten, wenn ein Patient Selbstmordgedanken äußert. Beheben Sie die Geisteskrankheit und die Suizidalität würde verschwinden. Doch die Zeit hat gezeigt, dass dies nicht immer funktioniert.
Um ehrlich zu sein, denken viele Patienten, die mit Depressionen zu kämpfen haben, nie über Selbstmord nach, während bei mehr als der Hälfte derjenigen, die sich das Leben nehmen, nie eine psychische Erkrankung diagnostiziert wurde. Diese Trennung sagt uns etwas Wichtiges: Selbstmord ist nicht nur ein Symptom einer Depression. Wenn wir Selbstmord wirklich verhindern wollen, müssen wir ihn als etwas Separates und Einzigartiges verstehen.
Als eine der häufigsten Todesursachen in Amerika muss dieses Verständnis schnell erfolgen. Selbstmord fordert zu viele Menschenleben, oft ohne Vorwarnung. Aber diejenigen, die dem Rand am nächsten sind, scheinen am weitesten davon entfernt zu sein, nicht weil sie es sind – sondern weil wir durch die falsche Linse geschaut haben.
Selbstmord ist nicht nur eine verkappte Depression
Selbstmordverhalten entsteht durch eine komplexe Mischung von Faktoren – von biologischen über neurologische bis hin zu situativen Auslösern. Für viele geht es nicht um Depressionen; es geht um unerträgliche psychische Schmerzen. Gefühle von Scham, Angst, Einsamkeit, Schuldgefühlen und Hoffnungslosigkeit können so schwer auf einer Person lasten, dass Selbstmord als einziger Ausweg erscheint. Manchmal ist es einfach das Zusammentreffen mehrerer negativer Ereignisse auf einmal, etwa der Verlust einer Beziehung oder des Arbeitsplatzes, was zu einer kurzen Zeit der Hoffnungslosigkeit führt.
Interessanterweise zeigen Daten der Crisis Text Line, dass Menschen mit Selbstmordrisiko eher Wörter wie „Ibuprofen“ und „800 mg“ als Wörter wie „traurig“ oder „deprimiert“ verwenden, wenn sie um Hilfe bitten. Es ist eine Erinnerung daran, dass Hoffnungslosigkeit – der Glaube, dass es keinen Ausweg aus einem Problem gibt – ein zuverlässigerer Indikator für das Suizidrisiko sein kann als jedes Etikett zur psychischen Gesundheit.
Die Wissenschaft des Selbstmordes: Was wir lernen
Wenn wir unser Verständnis von Suizid vertiefen, beginnen wir zu erkennen, dass es auch biologische Wurzeln hat. Eine Studie mit über 29.000 Personen, die einen Selbstmordversuch unternommen hatten, deckte einen genetischen Zusammenhang auf, der auf eine Veranlagung zur Suizidalität schließen lässt. Dieser genetische Zusammenhang überschneidet sich mit anderen Problemen wie Schlafstörungen, chronischen Schmerzen und Drogenmissbrauch, die oft zusammen mit Suizidalität auftreten, auch ohne dass eine Depression vorliegt.
Zusätzlich zur Genetik gibt es auch physische Veränderungen im Gehirn, die wir allmählich besser verstehen. Menschen, die durch Suizid sterben, weisen häufig Unterschiede im präfrontalen Kortex auf, dem Bereich, der für die Entscheidungsfindung verantwortlich ist, sowie einen niedrigeren Serotoninspiegel, der die Stimmung reguliert. Wir sehen diese Gehirnveränderungen unabhängig davon, ob bei der Person jemals eine psychische Erkrankung diagnostiziert wurde oder nicht, und betonen, dass Selbstmord als eigenständige Erkrankung betrachtet werden muss.
Dem Gesundheitssystem entgehen wichtige Chancen
Trotz allem, was wir über die Komplexität von Selbstmord herausgefunden haben, ist das Gesundheitssystem immer noch nicht vollständig darauf vorbereitet, damit umzugehen. Fast die Hälfte aller Menschen, die durch Suizid sterben, haben im letzten Monat ihres Lebens einen Arzt aufgesucht, ohne dass auf ihr Risiko hingewiesen wurde. Oft zeigen diese Patienten keine offensichtlichen psychischen Symptome, sodass die kritischen Warnzeichen übersehen werden.
Schlimmer noch: Die meisten psychiatrischen Fachkräfte sind nicht ausdrücklich in der Beurteilung oder Behandlung von Suizidrisiken geschult. Und wenn Patienten wegen Suizidalität ins Krankenhaus eingeliefert werden, steigt ihr Risiko oft nach der Entlassung – Untersuchungen zeigen, dass die Suizidwahrscheinlichkeit unmittelbar nach einem psychiatrischen Krankenhausaufenthalt um 400 % steigt. Leider werden viele Menschen in ihre Gemeinden entlassen, ohne darauf vorbereitet zu sein, sie in dieser kritischen Zeit zu unterstützen.
Auch unsere Diagnosepraktiken sind unzureichend. Das Screening auf Suizidgefahr konzentriert sich in der Regel auf explizite Suizidgedanken, aber was ist mit den tieferen Gefühlen der Hoffnungslosigkeit oder den genetischen und neurologischen Faktoren, die nicht so offensichtlich sind? Wir brauchen einen breiteren, differenzierteren Ansatz.
Suizidprävention: Was sich ändern muss
Um wirklich etwas zu bewirken, müssen wir zunächst dafür sorgen, dass Gesundheitsdienstleister besser in der Suizidprävention geschult werden. Derzeit verlangen nur neun Bundesstaaten eine suizidspezifische Ausbildung für Kliniker. Die landesweite Ausweitung dieser Ausbildung ist von entscheidender Bedeutung. Und wir brauchen mehr als nur Fähigkeiten zur Risikoerkennung; Gesundheitsdienstleister sollten darin geschult werden, Suizidalität als eigenständige Erkrankung zu behandeln.
Darüber hinaus gibt es bereits Hinweise darauf, dass spezielle Suizidpräventionsprogramme Versuche und Todesfälle drastisch reduzieren können. Klinisch validierte Behandlungspfade können im Vergleich zu Standardbehandlungen die Zahl der Suizidversuche verringern. Dies ist ein gewaltiger Schritt in die richtige Richtung und unterstreicht die Notwendigkeit einer suizidspezifischen Betreuung – genau wie jemand mit einer Herzerkrankung an einen Kardiologen überwiesen wird, sollte jemand, bei dem das Risiko eines Suizids besteht, von einem speziell darin ausgebildeten Fachmann untersucht werden Umgang mit Suizidalität.
Schließlich müssen wir unsere Sicht auf Suizidprävention ändern. Es geht nicht nur darum, Depressionen oder Angstzustände anzugehen – es geht darum, das gesamte Spektrum an Faktoren zu interpretieren, von der Biologie bis hin zu den Lebensumständen, die jemanden an den Rand drängen können. Es geht darum, ein System zu schaffen, in dem sich gefährdete Menschen auf eine Weise gesehen, gehört und unterstützt fühlen, die auf ihre individuellen Erfahrungen zugeschnitten ist. Indem wir uns diesem umfassenderen, einfühlsameren und recherchierenden Ansatz zuwenden, können wir beginnen, die Ergebnisse für unzählige Menschen und ihre Familien zu verändern . Jetzt ist es an der Zeit zu handeln, und die Leben, die wir retten könnten, sind jeden Versuch wert, unsere Perspektive zu ändern.
Foto: Wacharaphong, Getty Images
Neil Leibowitz MD, JD ist leitender Arzt und Chief Medical Officer bei Vita Health, einem Telegesundheitsunternehmen, das komplexe Pflege anbietet und die Selbstmordepidemie bekämpft. Dort betreut er den Unternehmensverkauf, das Account Management und die Psychiatrie. Zuvor war er Chief Medical Officer für Verhaltensgesundheit bei Elevance/Carelon, wo er Medical Affairs, das Produktteam und das Pflegebereitstellungsteam leitete. Sein Fokus liegt auf der Schnittstelle zwischen Technologie und Pflege. Zu seinen früheren Positionen zählen der Chief Medical Officer bei Talkspace und der Senior Medical Director bei Optum. Neil war Teil von Teams, die Unternehmen aufgebaut haben, die sowohl öffentliche als auch private Exits nach sich gezogen haben. Derzeit ist er Vorstandsmitglied von VIP, einem großen staatlich anerkannten Gesundheitszentrum in New York. Er erhielt seinen BA von der Johns Hopkins University, seinen MD vom New York Medical College und seinen JD von der New York University.
Dieser Beitrag erscheint über das MedCity Influencers-Programm. Über MedCity Influencer kann jeder seine Sicht auf Wirtschaft und Innovation im Gesundheitswesen auf MedCity News veröffentlichen. Klicken Sie hier, um herauszufinden, wie.