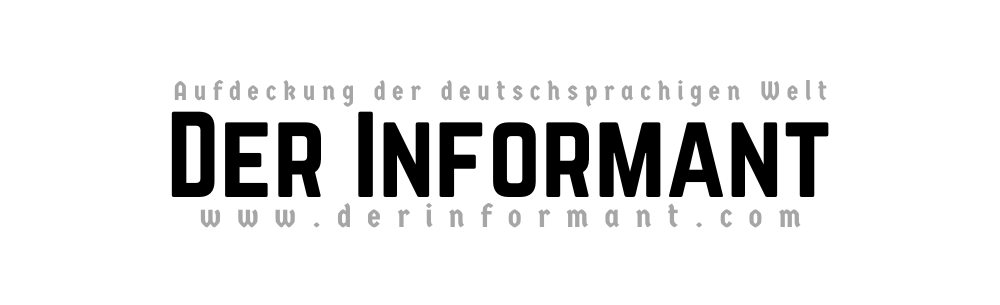Auf der 68. Tagung der Suchtstoffkommission (CND68) in Wien brachte eine wichtige Nebenveranstaltung mit dem Titel Unterstützung von Initiativen zur Drogenaufklärung und -prävention Experten, politische Entscheidungsträger und ehemalige Konsumenten zusammen, um über die Gefahren des Drogenkonsums und die Bedeutung der Prävention zu diskutieren. Die Veranstaltung wurde von der „Fundacion para la Mejora de la Vida la Cultura y la Sociedad (Stiftung zur Verbesserung von Leben, Kultur und Gesellschaft)“ organisiert, einer internationalen Stiftung, die sich mit vielen gesellschaftlichen Problemen befasst und dabei einen Bildungs- und Lernansatz sowie ein wichtiges Programm zur Drogenprävention verfolgt. Sie wurde mit Unterstützung des spezialisierten Netzwerks der Stiftung für ein drogenfreies Europa organisiert, das über 100 Basisgruppen in Europa umfasst, die Einzelprävention mit der Kampagne „The Truth About Drugs“ durchführen.
Diese Nebenveranstaltung unterstrich die dringende Notwendigkeit koordinierter globaler Maßnahmen zur Eindämmung der steigenden Flut des Drogenmissbrauchs, der weiterhin Gemeinden weltweit verwüstet.
Julie Delvaux, UNODC-Vertreterin für den ECOSOC, würdigte die Fundacion Mejora und gab den Ton für die Sitzung an, indem sie die Notwendigkeit eines frühzeitigen Eingreifens betonte: „Je früher wir handeln, desto mehr Leben können wir retten und desto mehr können wir den durch Drogen verursachten Schaden verringern.“ Sie betonte, dass Drogenkonsum nicht nur ein Gesundheitsproblem, sondern eine soziale Krise sei, die sich auf mehrere Bereiche auswirke, darunter Kriminalitätsraten, wirtschaftliche Stabilität und psychische Gesundheit. Angesichts von Millionen betroffener Menschen weltweit ist die Herausforderung immens, und Prävention erweist sich als die langfristig wirksamste Lösung.
Bei der Veranstaltung traten verschiedene Redner auf, von Wissenschaftlern bis hin zu ehemaligen Konsumenten illegaler Drogen, die sich alle für eine starke Aufklärung im Bildungsbereich einsetzten, um das Bewusstsein für die Gefahren von Drogen zu schärfen und umfassende Präventionsmaßnahmen zu ergreifen. Ihre Erkenntnisse zeichneten ein klares Bild des Drogenproblems und bekräftigten, dass sich die Gesundheitspolitik auf die Verhinderung des Erstkonsums konzentrieren sollte, anstatt die Sucht zu bekämpfen, nachdem sie bereits eingesetzt hat.
Synthetische Cannabinoide: Die versteckte Gefahr
Robert Galibert, Präsident der Stiftung für ein drogenfreies Europa (FDFE) und Biochemieexperte, gab eine wissenschaftliche Analyse der synthetischen Cannabinoide, die eine wachsende Bedrohung auf den weltweiten Drogenmärkten darstellen. In seinem Vortrag ging er auf die biochemischen Mechanismen ein, durch die diese Substanzen mit dem menschlichen Körper interagieren, und erklärte, dass sie weitaus wirksamer sind als natürliches Cannabis und erhebliche Risiken für die psychische und physische Gesundheit bergen.
„Diese Substanzen sind weitaus stärker und gefährlicher als natürliches Cannabis“, warnte Galibert. Er erläuterte, wie synthetische Cannabinoide, die ursprünglich für die medizinische Forschung entwickelt wurden, von illegalen Herstellern missbraucht wurden, die legale Schlupflöcher ausnutzen wollten. Diese unregulierten Substanzen haben zu schweren gesundheitlichen Komplikationen geführt, darunter Herzprobleme, schweres Erbrechen, Halluzinationen und in einigen Fällen tödliche Überdosierungen.
Er erklärte, wie synthetische Cannabinoide das körpereigene Endocannabinoid-System stören, das eine entscheidende Rolle bei der Regulierung von Stimmung, Gedächtnis und dem allgemeinen physiologischen Gleichgewicht spielt. Ähnlich wie Phytocannabinoide (die in Cannabis vorkommen) binden diese synthetischen Ersatzstoffe an Cannabinoid-Rezeptoren, aktivieren sie jedoch viel stärker, was zu extremen und unvorhersehbaren Wirkungen führt.
Er wies auf die Fettlöslichkeit von Cannabis hin, die es ermöglicht, dass es sich im Körper ansammelt und eine anhaltende Beeinträchtigung verursacht. „Die Ausscheidung von THC dauert Wochen, was bedeutet, dass ein Konsument noch lange nach dem Konsum unter dem Einfluss steht“, sagte er. Er verglich es mit Alkohol und fügte hinzu: „Alkohol wird innerhalb von 24 Stunden ausgeschieden, aber THC (wie auch Phyto- oder synthetische Cannabinoide) verbleibt wochenlang im Fettgewebe, wodurch seine Wirkung lange anhält und unterschätzt wird.“ Diese Erkenntnis ist besonders wichtig in der Debatte um die Legalisierung von Cannabis, da sie das Missverständnis in Frage stellt, dass der Konsum von Marihuana harmlos oder leicht zu handhaben sei.
Das Zeugnis eines ehemaligen Süchtigen: Die wahren Auswirkungen des Drogenkonsums
Der vielleicht bewegendste Moment der Veranstaltung kam von Stephanie, einer ehemaligen Drogenkonsumentin aus der Schweiz. In ihrer Rede auf Französisch schilderte sie ihren Abstieg in die Sucht, der mit Cannabis begann und schnell zu LSD, Kokain, Heroin und Methadon eskalierte. Ihr offener Bericht enthüllte die progressive Natur der Drogenabhängigkeit und stellte die Vorstellung in Frage, dass Cannabiskonsum ein Freizeitvergnügen bleiben kann, ohne zu weiterem Substanzmissbrauch zu führen.
Sie beschrieb, wie Gruppenzwang sie zum Experimentieren verleitete: „Anfangs wollte ich nicht Teil der Gruppe sein. Aber mit der Zeit fühlte ich mich isoliert. Also gab ich nach.“ Wie viele junge Menschen fühlte sie sich von den sozialen Aspekten des Drogenkonsums angezogen, ohne sich der langfristigen Folgen bewusst zu sein. Ihre Geschichte ist eine deutliche Mahnung, dass Drogenabhängigkeit oft mit einer sozialen Normalisierung beginnt – eine scheinbar harmlose Entscheidung kann zu einer verheerenden Abhängigkeit führen.
Ihr Wendepunkt kam, als sie sich „an einem Ort ohne Geld, ohne Zuhause und mit viel Schmerz“ wiederfand, mittellos und unter schweren Entzugserscheinungen leidend. „Ich war am Boden. Da wusste ich, dass ich mich ändern musste“, verriet sie. Nach mehreren gescheiterten Versuchen, sich zu rehabilitieren, gelang es ihr schließlich, ihre Sucht zu überwinden. Nachdem sie ihr Leben wieder in den Griff bekommen und ein Unternehmen aufgebaut hatte, das etwa 30 Menschen Arbeit bietet, hat sie es sich zur Aufgabe gemacht, anderen zu helfen, dasselbe Schicksal zu vermeiden.
Ihre Geschichte war ein eindrucksvoller Beweis für die Notwendigkeit von Prävention und Aufklärung. Sie betonte, dass sie, wenn sie als Jugendliche richtig über die Gefahren von Drogen aufgeklärt worden wäre, vielleicht einen anderen Weg eingeschlagen hätte. Sie forderte die politischen Entscheidungsträger auf, frühzeitige Aufklärungsprogramme in Schulen einzuführen, um Kindern das Wissen und die Widerstandsfähigkeit zu vermitteln, die sie benötigen, um dem Druck von Gleichaltrigen zu widerstehen.
Die wissenschaftliche und politische Debatte über Cannabis
Dr. Francis Nde, medizinischer Berater des Rates der Europäischen Union, konzentrierte sich auf die gesundheitlichen Folgen des Cannabiskonsums. Er zitierte Studien, die Cannabiskonsum mit Hodenkrebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und psychischen Störungen wie Schizophrenie in Verbindung bringen. „Die Auswirkungen von Cannabis sind nicht nur kurzfristig, sondern werden über Generationen weitergegeben“, betonte er und bezog sich dabei auf aktuelle Studien zu epigenetischen Effekten. Er forderte die Regierungen auf, diese wissenschaftlichen Erkenntnisse bei der Legalisierung von Cannabis zu berücksichtigen, und argumentierte, dass die öffentliche Gesundheit Vorrang vor wirtschaftlichen Anreizen oder politischem Druck haben sollte.
Eine angespannte Diskussion entstand, als ein Psychologe aus Polen die Frage aufwarf, ob Alkohol anstelle von Cannabis als primäre Einstiegsdroge betrachtet werden sollte. Galibert antwortete mit wissenschaftlichen Daten und bekräftigte, dass Alkohol zwar ein Risikofaktor ist, Cannabis jedoch aufgrund seiner anhaltenden Wirkung auf das Gehirn ein stärkerer Prädiktor für den Übergang zu härteren Drogen ist. Er erläuterte, wie THC die Gehirnchemie verändert und Menschen anfälliger dafür macht, nach stärkeren Substanzen zu suchen, um ähnliche Effekte zu erzielen.
Ein weiteres kontroverses Thema war die mögliche Legalisierung von medizinischem Cannabis in der Ukraine. Dr. Olena Shcherbakova, leitende Forscherin an der Nationalen Akademie der Medizinischen Wissenschaften der Ukraine, stellte die Ergebnisse ihrer Forschung mit Dr. Heorhii Danylenko vor und warnte vor Legalisierungsbemühungen: „Wir kennen die Risiken und arbeiten aktiv daran, eine Legalisierung zu verhindern. Aber wir sind mit starken Lobbybemühungen konfrontiert.“ Ihre Ausführungen unterstrichen die geopolitischen und politischen Herausforderungen im Zusammenhang mit der Regulierung von Cannabis. Die Debatte machte die globale Kluft in der Drogenpolitik deutlich, bei der einige Nationen auf eine Legalisierung drängen, während andere für die Aufrechterhaltung strenger Vorschriften zum Schutz der öffentlichen Gesundheit kämpfen.
Der Weg in die Zukunft für Prävention und Politik
Zum Abschluss der Sitzung wiederholte Delvaux die zentrale Botschaft: Prävention durch Bildung, frühzeitiges Eingreifen und internationale Zusammenarbeit ist im Kampf gegen Drogenmissbrauch von entscheidender Bedeutung. Sie forderte größere Investitionen in öffentliche Aufklärungskampagnen, schulbasierte Präventionsprogramme und grenzüberschreitende Zusammenarbeit, um die sich entwickelnde Drogenkrise zu bewältigen.
Stephanies Geschichte, Galiberts wissenschaftliche Analyse, Dr. Ndès medizinische Expertise und die Beiträge von Dr. Shcherbakova und Dr. Danylenko wiesen alle auf die dringende Notwendigkeit strengerer Richtlinien und breit angelegter Aufklärungskampagnen hin. Die Redner warnten davor, dass Legalisierungsbestrebungen, insbesondere für Cannabis, ein erhebliches Risiko für die öffentliche Gesundheit darstellen und mit soliden Präventionsstrategien bekämpft werden sollten. Die Veranstaltung auf der CND68 machte deutlich: Der Kampf gegen den Drogenmissbrauch ist noch lange nicht vorbei. Aber mit Aufklärung, starken Richtlinien und internationaler Zusammenarbeit können Fortschritte erzielt werden, um die Schwächsten – insbesondere die Jugend – vor den verheerenden Folgen der Drogenabhängigkeit zu schützen.