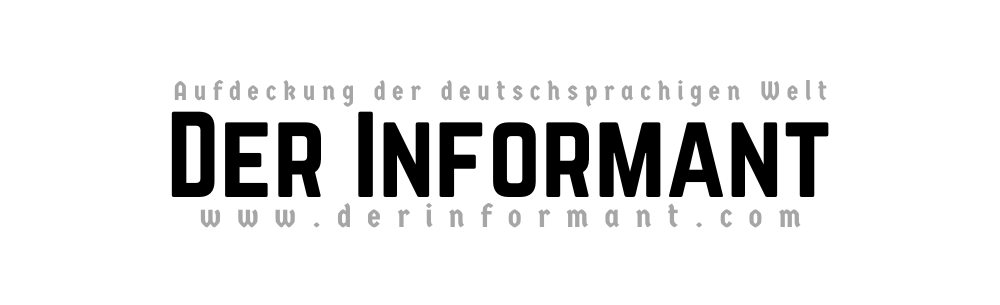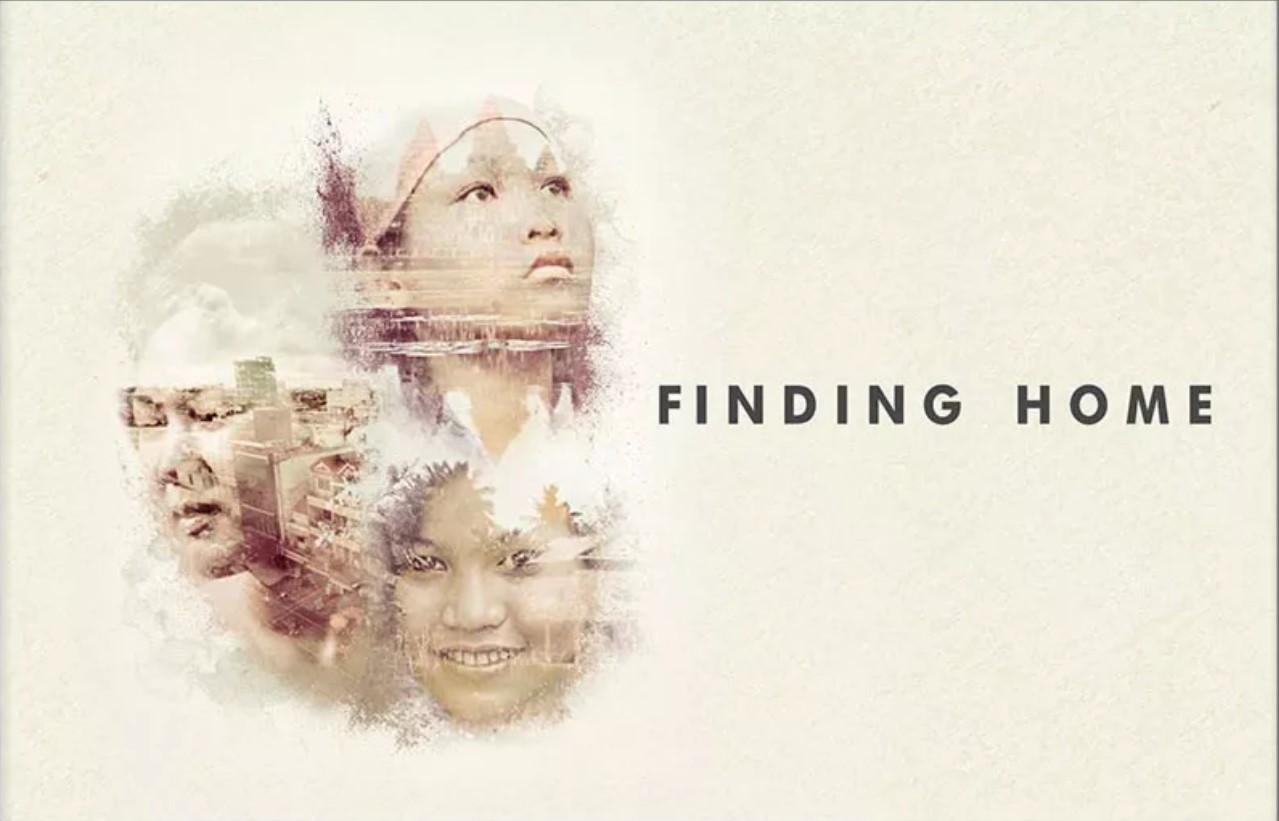Von Will Dunham
(Reuters) -Die Sahara -Wüste ist einer der trockensten und verlassensten Orte der Erde und erstreckt sich über eine Reihe von Nordafrika, die Teile von 11 Ländern umfasst und ein mit China oder den Vereinigten Staaten vergleichbares Gebiet abdeckt. Aber es war nicht immer so unwirtlich.
In einer Zeit von etwa 14.500 bis 5.000 Jahren war es eine üppige grüne Savannen, die reich an Wasser und dem Leben war. Und laut DNA, die aus den Überresten von zwei Personen erhalten wurden, die vor etwa 7.000 Jahren in der heutigen Libyen lebten, war es eine mysteriöse Linie von Menschen, die von der Außenwelt isoliert wurden.
Die Forscher analysierten die ersten Genome von Menschen, die in der sogenannten „grünen Sahara“ lebten. Sie erhielten DNA von den Knochen zweier Weibchen, die in einem Felsenheim namens Takarkori im abgelegenen südwestlichen Libyen vergraben waren. Sie wurden natürlich mumifiziert und repräsentierten die ältesten bekannten mumifizierten menschlichen Überreste.
„Zu dieser Zeit war Takarkori eine üppige Savannah mit einem nahe gelegenen See, im Gegensatz zur heutigen trockenen Wüstenlandschaft“, sagte der Archäogenetiker Johannes Krause vom Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology, einer der Autoren der Studie, die diese Woche in der Zeitschrift Nature veröffentlicht wurde.
Die Genome zeigen, dass die Takarkori-Individuen Teil einer ausgeprägten und zuvor nicht identifizierten menschlichen Abstammung waren, die seit Tausenden von Jahren von Subsahara- und Eurasischen Populationen getrennt lebte.
„Interessanterweise zeigen die Takarkori -Leute keinen signifikanten genetischen Einfluss von Bevölkerungsgruppen südlich der Sahara bis in die südlichen oder nahen Osten und prähistorische europäische Gruppen im Norden. Dies deutet darauf hin, dass sie trotz praktizierender Tierhaltung genetisch isoliert blieben – eine kulturelle Innovation, die außerhalb Afrikas stammt“, sagte Krause.
Archäologische Beweise deuten darauf hin, dass diese Menschen Pastoralisten waren und domestizierte Tiere hütten. Vor Ort gefundene Artefakte umfassen Werkzeuge aus Stein, Holz und Tierknochen, Keramik, gewebten Körben und geschnitzten Figuren.
Die Vorfahren der beiden Takarkori-Individuen stellten sich von einer nordafrikanischen Abstammung ab, die vor etwa 50.000 Jahren von Subsahara-Bevölkerungsgruppen getrennt war. Das fällt ungefähr zusammen mit der Zeit, in der sich andere menschliche Abstammungslinien über den Kontinent und in den Nahen Osten, Europa und Asien hinaus ausbreiten und die Vorfahren aller Menschen außerhalb Afrikas werden.
„Die Takarkori -Linie stellt wahrscheinlich einen Überrest der genetischen Vielfalt dar, die vor 50.000 und 20.000 Jahren in Nordafrika vorhanden ist“, sagte Krause.
„Ab 20.000 Jahren zeigen genetische Beweise einen Zustrom von Gruppen aus dem östlichen Mittelmeer, gefolgt von Migrationen von Iberia und Sizilien vor etwa 8.000 Jahren. Aus Gründen, die noch unbekannt waren, wurde die Takarkori -Linie jedoch mehr als erwartet.
Ihre Linie blieb während des größten Teils ihrer Existenz isoliert, bevor die Sahara wieder unbewohnbar wurde. Am Ende einer wärmeren und feuchteren Klimaphase namens African Feuchtzeit verwandelte sich die Sahara in die weltweit größte heiße Wüste von ungefähr 3.000 v. Chr.
Mitglieder unserer Spezies Homo Sapiens, die sich über Afrika über Afrika hinausbreiten und mit Neandertaler-Populationen, die bereits in Teilen von Eurasien vorhanden waren, und ein dauerhaftes genetisches Erbe in nicht-afrikanischen Populationen hinterlassen haben. Aber die grünen Sahara -Leute trugen nur Spurenmengen von Neandertaler -DNA und veranschaulichen, dass sie kaum Kontakt mit externen Populationen hatten.
Obwohl die Bevölkerung von Takarkori selbst vor etwa 5.000 Jahren verschwand, als die afrikanische feuchte Zeit endete und die Wüste zurückkehrte, bestehen die Spuren ihrer Vorfahren heute unter verschiedenen nordafrikanischen Gruppen, sagte Krause.
„Ihr genetisches Erbe bietet eine neue Perspektive auf die tiefe Geschichte der Region“, sagte Krause.
(Berichterstattung nach Will Dunham in Washington; Redaktion von Daniel Wallis)